Elektroautofahrer müssen immer im Blick haben, wo die nächste Möglichkeit zum Aufladen zur Verfügung steht, was mitunter zu logistischen Herausforderungen führen kann. In Deutschland gibt es bereits ein flächendeckendes Ladenetz, die meisten Ladestationen findet man entlang der wichtigsten Verkehrsachsen und rund um größere Städte. Auf dem Land sind sie bisher weniger weitverbreitet. Besonders praktisch und komfortabel ist es aber natürlich, wenn das eigene Auto zuhause mit Energie versorgt werden kann. Dafür eignet sich am besten eine Wallbox. Doch bevor Haus- oder Wohnungseigentümer beziehungsweise Mieter zur Tat schreiten und eine solche einbauen lassen sind technische, organisatorische und rechtliche Fragen zu klären.
Was ist eine Wallbox und warum ist sie notwendig?
Hybridmodelle und E-Autos können in Ausnahmefällen zwar auch an Haushaltssteckdosen aufgeladen werden, dies dauert jedoch deutlich länger und birgt Sicherheitsrisiken. Die Leitungen sind nicht für Dauerbelastungen dieser Art ausgelegt, weshalb es zu Überhitzung, Kurzschlüssen oder sogar Kabelbränden kommen kann. Eine Wallbox ist eine an der Wand montierte Ladestation speziell für Elektrofahrzeuge, die über eine höhere Ladeleistung verfügt und die Aufladung zudem überwacht sowie bei Bedarf den Stromfluss reguliert. Typischerweise kann ein E-Auto wie der vollelektrische Skoda Enyaq etwa fünfmal schneller, sicherer und gleichzeitig günstiger an einer Wallbox aufgeladen werden als an einer Haushaltssteckdose. Wenn man sein Auto regelmäßig zu Hause laden möchte, ist eine Wallbox also eine sehr nützliche Investition.
Wallbox am Eigenheim installieren
Wer Alleineigentümer eines Einfamilienhauses mit eigenem Stellplatz oder Garage ist, hat es am einfachsten. Hier ist es in der Regel nicht notwendig, Rücksprache mit anderen zu halten und die Wallbox kann von Fachkräften am Wunschort installiert werden. Dabei wird zunächst geprüft, ob die vorhandene Hausanschlussleistung ausreichend groß ist. Gegebenenfalls ist eine Erweiterung durch den Netzbetreiber nötig. Außerdem muss die Wallbox im Vorfeld beim Netzbetreiber angemeldet werden. Die Anmeldung erfolgt in der Regel durch den beauftragten Elektroinstallateur über ein standardisiertes Formular. Wenn die Wallbox eine Ladeleistung von mehr als 11 kW haben soll, ist eine Genehmigung erforderlich. Wallboxen werden an Starkstrom angeschlossen, ist kein entsprechender Anschluss am gewählten Standort vorhanden, muss erst ein Kabel als Anschlussleitung gelegt werden, was die Installation deutlich aufwendiger und kostenintensiver macht. Im Zuge dessen kann auch ein LAN-Kabel verlegt werden, um eine smarte Wallbox zuverlässig mit dem Internet zu verbinden. Unter Umständen müssen darüber hinaus zusätzliche Sicherungen eingebaut werden. In der Regel kann die Wallbox-Installation dennoch innerhalb eines Tages realisiert werden. Um einer Überlastung des Stromnetzes vorzugreifen, hat der Netzbetreiber seit 2024 nach § 14a EnWG das Recht, Verbrauchseinrichtungen wie private Wallboxen zu steuern. Zu diesem Zweck müssen sie mit einem intelligenten Messsystem und einer Steuereinrichtung ausgestattet sein. Ist mit einem Engpass zu rechnen, darf die Leistung der Wallbox vom Netzbetreiber reduziert werden, allerdings nur für kurze Zeit. Diese Regelung hat den Vorteil, dass Netzbetreiber den Anschluss einer Wallbox aus Netzkapazitätsgründen nicht mehr so leicht ablehnen oder verzögern können.
Wallboxen für Mehrfamilienhäuser
Seit der Reform des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) 2020 haben Wohnungseigentümer einen gesetzlichen Anspruch auf den Einbau einer Ladeeinrichtung (§ 20 WEG). Sie müssen jedoch in der Eigentümergemeinschaft einen Antrag auf Genehmigung stellen. Die Eigentümergemeinschaft darf den Einbau ohne triftige Gründe nicht ablehnen, aber über die Ausführung mitentscheiden. Triftige Gründe können beispielsweise bei denkmalgeschützten Gebäuden oder wegen technischer Unmöglichkeit vorliegen. Die Kosten trägt grundsätzlich der Antragsteller, es sei denn, die Ladestation soll gemeinschaftlich genutzt werden. Nach § 554 BGB haben auch Mieter einen Anspruch auf die Genehmigung des Einbaus einer Ladeinfrastruktur. Der Vermieter darf die Zustimmung ebenfalls nur auch triftigen Gründen verweigern und Anforderungen an die Ausführung stellen. Der Mieter trägt die Installations- und Rückbaukosten, sofern nichts anderes vereinbart ist.
Wichtig für Bauherren und Eigentümer
Ein wichtiger gesetzlicher Rahmen für Ladeinfrastruktur ist das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG), das seit März 2021 in Kraft ist. Es verpflichtet Bauherren und Eigentümer bei Neubauten und größeren Renovierungen von Wohn- und Nichtwohngebäuden unter bestimmten Voraussetzungen dazu, die Ladeinfrastruktur für E-Mobilität vorzubereiten. Konkret bedeutet das: Bei Wohngebäuden mit mehr als fünf Stellplätzen muss jeder Stellplatz mit Leerrohren für Elektrokabel ausgestattet werden, um eine spätere Nachrüstung zu erleichtern. Bei Nichtwohngebäuden mit mehr als sechs Stellplätzen muss mindestens ein Ladepunkt direkt installiert werden.
Schutzmaßnahmen
Beim Betrieb einer Wallbox, insbesondere im Außenbereich oder in gemeinschaftlich genutzten Tiefgaragen, sollten geeignete Schutzmaßnahmen gegen Diebstahl, Vandalismus und unbefugte Nutzung vorgesehen werden. Moderne Wallboxen verfügen über integrierte Sicherheitsfunktionen wie Zugangskontrolle per RFID-Chip, App oder Schlüssel, was auch einen wirksamen Schutz vor Stromdiebstahl bietet. Ein abschließbares Gehäuse erhöht den Schutz zusätzlich. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass ausreichend Belüftung möglich ist, da beim Laden Hitze entsteht. Ladekabel können leicht gestohlen werden. Modelle mit Typ-2-Stecker haben eine automatische Verriegelung, sodass sie während des Ladens nicht entfernt werden können. Wird die Wallbox draußen angebracht, sollte für Witterungschutz gesorgt werden. Wallboxen mit der Schutzklasse IP44, IP54 oder IP67 sollen Regen und Schnee trotzen können, eine Überdachung ist dennoch empfehlenswert. Abschließend sollte die Wallbox versichert werden. Je nach Police kann sie in der KFZ- oder Hausratsversicherung oder bei fester Montage am Gebäude auch in der Wohngebäudeversicherung mitaufgenommen werden.
Abrechnung mehrere Nutzer
In gemeinschaftlich genutzten Ladeeinrichtungen ist eine verbrauchsabhängige Abrechnung notwendig, um Streitigkeiten zu vermeiden. Moderne Ladeinfrastrukturen, vor allem bei halböffentlichen oder gemeinschaftlichen Nutzungen, setzen zunehmend auf digitale Ladesysteme mit angebundenem Backend. Nutzer authentifizieren sich per RFID-Chip, Smartphone-App oder Nutzerkonto, bevor sie laden. Das System protokolliert dann automatisch den Verbrauch, rechnet den Strom nutzergenau ab und stellt individuelle Rechnungen.
Wallboxen an Wohnhäusern sind längst kein Nischenthema mehr. Dank der aktuellen Bestrebungen zur Förderung von E-Mobilität steigt die Nachfrage merklich, die Installation wird zunehmend einfach. Weder Mieter noch Wohnungseigentümer müssen auf eine Wallbox verzichten, sofern sie bereit sind, die Rahmenbedingungen zu erfüllen. Immobilieneigentümer sollten diese Entwicklungen nicht verschlafen. Wer heute schon Ladeinfrastruktur schafft, steigert nicht nur den Wohnwert, sondern investiert auch in die Zukunft, in der Ladepunkte voraussichtlich zur Pflicht werden.




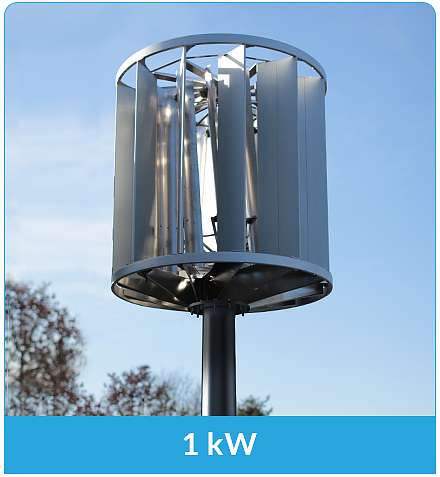
Kommentar hinterlassen